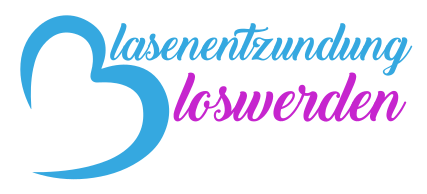Die durch Medikamente verursachte Blasenentzündung. Es handelt sich um eine nicht infektiöse Form von Zystitis, die nach der Einnahme bestimmter Medikamente auftritt. In den meisten Fällen handelt es sich um Substanzen, die zwei Hauptmerkmale aufweisen:
- Sie besitzen eine gewisse dosisabhängige Urotoxizität.
- Sie werden über das Harnsystem ausgeschieden.
Wie erkennt man sie?
Die am häufigsten festgestellte Symptome sind: Harndrang, Dysurie, Schmerzen im suprapubischen Bereich und Hämaturie (Blut im Urin) von leicht bis schwer. Der Urinkultur ist negativ (obwohl manchmal eine bakterielle Infektion auftreten kann); das Urothel ist stark entzündet und gereizt.
Welche Medikamente können eine abakterielle Zystitis verursachen?
Chemotherapeutische und immunsuppressive Medikamente
Die hämorrhagische Zystitis gehört zu den häufigsten unerwünschten Reaktionen auf chemotherapeutische Behandlungen. Unter den antineoplastischen Medikamenten ist das Bekannteste für seine Nebenwirkungen im Harntrakt sicherlich Cyclophosphamid. Es handelt sich um ein alkylierendes und immunsuppressives Mittel, das bei der Behandlung vieler Neoplasien eingesetzt wird, wie lymphatischer und nicht-lymphatischer Leukämie, Morbus Hodgkin, Non-Hodgkin-Lymphomen und Multiplem Myelom. Es weist eine hohe Toxizität für die Nieren und die Harnwege im Allgemeinen auf, weshalb seine Anwendung zu einer hämorrhagischen Zystitis führen kann, deren Inzidenz bis zu 70% betragen kann. Hauptverantwortlich für die renale Toxizität ist Acrolein, eine Substanz, die durch den Abbau von Cyclophosphamid im Körper entsteht. Ähnlich wie Cyclophosphamid kann auch Ifosphamid bei 20-40% der behandelten Patienten eine hämorrhagische Blasentzündung (Mikro- und Makrohämaturie) verursachen. Maßnahmen zur Verhinderung der durch die Chemotherapie verursachten hämorrhagischen Zystitis betreffen die Reduzierung der Acroleinkonzentration und die Kontaktzeit mit dem Urothel. Nach verschiedenen Studien soll N-Acetylcystein (NAC) in der Lage sein, dieser Metabolit zu binden und zu inaktivieren, um die toxischen Wirkungen im Harntrakt zu verhindern.
FANS
Tiaprofensäure: Ein nicht-steroidales entzündungshemmendes Medikament (NSAID), das zur Behandlung von entzündlichen und degenerativen rheumatischen und muskuloskelettalen Erkrankungen angezeigt ist. Die durch die Einnahme dieses Arzneimittels verursachte Blasentzündung ist gut dokumentiert, und die Häufigkeit, mit der sie auftritt, ist 100-mal höher als bei der Einnahme anderer NSAIDs. Der biochemische Mechanismus ist nicht bekannt, aber da dieses Medikament nahezu vollständig auf renaler Ebene ausgeschieden wird, wird eine direkte reizende Wirkung auf das Urothel vermutet. Obwohl mit deutlich geringerer Inzidenz, wurden auch Nebenwirkungen im Harntrakt nach der Einnahme anderer nicht-steroidaler entzündungshemmender Medikamente wie Indometacin, Diclofenac, Ketoprofen, Naproxen und Piroxicam beobachtet.
Statine
Statine sind Medikamente, die üblicherweise zur Kontrolle der Cholesterinspiegel im Blut verwendet werden. Verschiedene Fallberichte deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Statinen und dem Auftreten von Harnsymptomen wie Hämaturie, chronischer Entzündung des Urothels, schmerzhaftem Blasensyndrom und interstitieller Zystitis hin. Der biochemische Mechanismus, der für diese unerwünschten Reaktionen verantwortlich ist, ist nicht bekannt.
Penicilline
Obwohl sie oft zur Behandlung von bakteriellen Harnwegsinfektionen verschrieben werden, können Penicilline und ihre synthetischen Derivate wie Methicillin, Carbenicillin, Ticarcillin und Piperacillin in seltenen Fällen eine hämorrhagische Blasentzündung durch einen immunologischen Mechanismus verursachen.
Medikamente zur Behandlung von Diabetes, die den SGLT2-Transporter hemmen
Die hohe Inzidenz von Harnwegsinfektionen bei Diabetikern steht auch im Zusammenhang mit der Verwendung einer Arzneimittelklasse, die als SGLT2-Transporter-Inhibitoren bekannt ist, auch Gliflozine genannt. Diese Medikamente hemmen die Glukoseresorption auf tubulärer Ebene und fördern deren Ausscheidung über den Urin. Aufgrund der Glukosurie, die durch die massive Ausscheidung von Glukose über den Urin verursacht wird, ist die Behandlung mit SGLT2-Inhibitoren häufig mit einem erhöhten Risiko von Harnwegsinfektionen verbunden, die in der Regel bereits kurze Zeit nach Beginn der Behandlung auftreten und den Patienten dazu zwingen, die Therapie abzubrechen. Es wurde geschätzt, dass solche Infektionen etwa 10% der mit SGLT-2-Inhibitoren behandelten Patienten betreffen und bei Frauen vor den Wechseljahren, bei Patienten mit einer Vorgeschichte von urogenitalen Infektionen und bei übergewichtigen Personen häufiger auftreten.
Bedeutung der Patienten-Kommunikation mit dem Arzt/medizinischem Fachpersonal
Die Häufigkeit von medikamenteninduzierten Harnwegsinfektionen wird wahrscheinlich unterschätzt und wenig anerkannt. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Schwierigkeiten bei der Feststellung einer kausalen Beziehung, geringe Bereitschaft der Ärzte und des medizinischen Personals, Nebenwirkungen zu melden, mangelnde angemessene Schulung und Information im Bereich der Arzneimittelüberwachung, Schwierigkeiten der Bürger bei der Ausfüllung des Meldeformulars für unerwünschte Arzneimittelwirkungen, Wahrnehmung einer übermäßigen Bürokratisierung.
Diese Bedingung, insbesondere wenn sie nicht erkannt und angemessen behandelt wird, kann ernsthafte Auswirkungen auf die Lebensqualität des Patienten haben und die Hauptursache für die Unterbrechung der medikamentösen Behandlung sein.
Eine unzureichende Therapieadhärenz führt zu einem Verlust der Wirksamkeit der medikamentösen Behandlung. Darüber hinaus kann sie das Auftreten von Komplikationen begünstigen, Rückfälle verursachen oder die Dauer der Krankheit verlängern. Aus öffentlicher Gesundheitssicht führt eine geringe Therapieadhärenz zu einer Verschwendung von Ressourcen: von ungenutzten Medikamenten bis hin zu vermeidbaren Krankenhausaufenthalten.